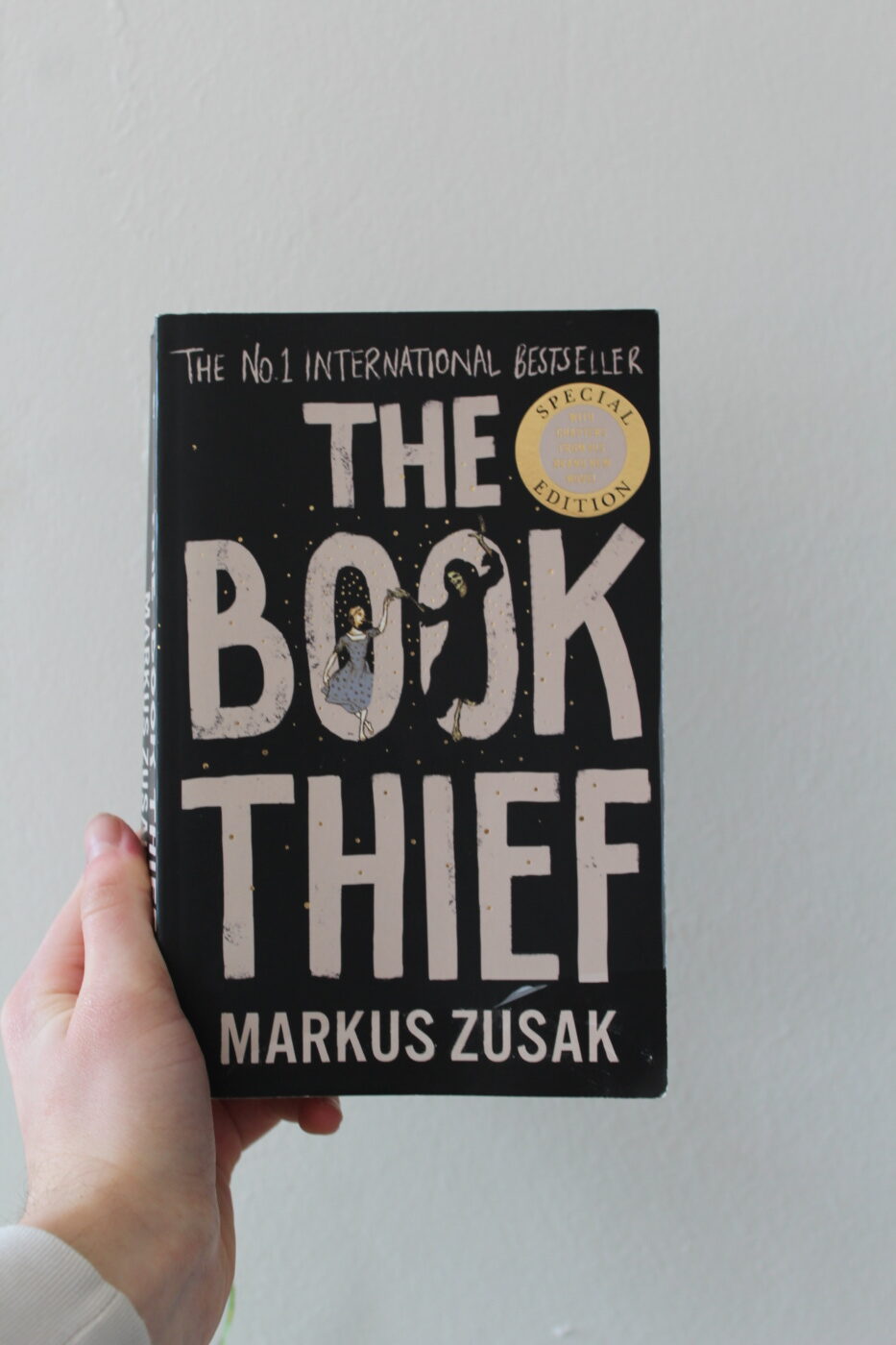Triggerwarnung: in diesem Text geht es um zwanghaftes und selbstverletzendes Verhalten.
Heute ist Montag. Ich steige aus der Bahn, es ist kalt. Mein Atem bildet Wolken und ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke bis zum Kinn. Das stört mich, weil der Stoff an meiner Haut reibt, also öffne ich den Reißverschluss wieder. Ich warte an der Ampel und schaue in den immer dunkler werdenden Himmel, bis das gelbe Ding an der Ampel zu vibrieren beginnt, und ich die Straße überqueren kann. Ich gehe nach rechts, weil ich immer nach rechts gehe, obwohl nach links der kürzere Weg nach Hause wäre. Ich will nicht nach Hause, will den Weg so lang wie möglich ausdehnen, auch wenn es kalt ist und dunkel. Ich gehe 223 Schritte und biege dann links ab – in eine kleine Gasse – und komme an einem Supermarkt vorbei. Davor steht ein Mann, der Zeitungen verkauft. Er steht immer hier, außer am Sonntag, weil am Sonntag das Geschäft nicht geöffnet hat. Ich weiß das, weil ich auch immer hier bin, jeden Tag, und im Vergleich zu ihm auch am Sonntag. Ich sage „Hallo“.
Ich sehe den Mann jeden Morgen, wenn ich herkomme, um etwas für mein Frühstück zu kaufen. Montags sind das Äpfel, dienstags Hafermilch, mittwochs Jogurt, am Donnerstag komme ich her, obwohl ich nichts brauche. Am Freitag kaufe ich Haferflocken und weil ich in einer Woche nicht eine Packung Haferflocken brauche, habe ich mittlerweile viel zu viele Haferflocken. Am Samstag komme ich her, um eine Banane zu kaufen, weil ich am Samstag immer Lust auf Bananen habe. Am Sonntag komme ich hierher, weil ich mich vergewissern muss, dass das Supermarkt auch wirklich geschlossen hat. Ich sehe den Mann jeden Tag um halb drei, weil ich da an ihm vorbei gehe, um spazieren zu gehen. Ich sehe den Mann jeden Tag um vier, weil ich da vom Spaziergang zurückkomme. Der Mann sagt „Hallo“, er lächelt. Er weiß also auch, dass ich jeden Morgen und jeden Nachmittag hier vorbeikomme. Er weiß nur nicht, dass ich auch am Sonntag hier bin – am Sonntag ist er nämlich nicht hier. Ich lächle ihn auch an und gehe über die Straße. Hier muss ich nicht nach links oder rechts schauen, weil gerade eine Baustelle ist und hier niemand fährt. Das finde ich schön.
Ich gehe weiter geradeaus, an einem kleinen Garten vorbei in dem ein Hase lebt. Auch heute ist sein Käfig offen, aber ich sehe ihn nicht in dem Garten, das macht mich traurig. Aber heute Morgen, als ich Äpfel einkaufen wollte, war er noch hier. Vom Garten mit dem Hasen sind es noch 612 Schritte bis nach Hause. Ich gehe langsamer. Irgendwann stehe ich doch vor unserem Tor und langsam, für mich fühlt es sich an wie in Zeitlupe, hole ich meinen Schlüssel aus meiner rechten Jackentasche und schließe auf. Hinter mir steht eine Frau mit einem Korb, die vermutlich auch in unserem Block wohnt, weil sie scheinbar darauf wartet, dass ich aufschließe. Ich habe sie noch nie gesehen, aber halte ihr trotzdem die Tür auf, weil man das so macht und weil es so aussieht, als könnte sie es mit ihrem Korb nicht selbst machen. Ich gehe zur Haustür und schließe auf. 27 Stufen bis zur Wohnungstür, da fällt mir ein, dass ich vergessen habe, in den Briefkasten zu sehen, also 27 Stufen bis nach unten. Wir haben keine Post. 27 Stufen nach oben, langsam schließe ich auf, ich bin auch ein bisschen außer Puste von den 81 Stufen. Ich gehe durch die Tür. Es ist dunkel in der Wohnung und ich atme auf. Ich bin allein. Ich höre den Kühlschrank. Ich ziehe meine Schuhe aus, stelle sie in den Schrank, ziehe meine Jacke aus, hänge sie auf, wickle meinen Schal ab und befreie mich von meinem Hut.
Ich gehe in mein Zimmer, es riecht nach Erde und nach Tee, ich ziehe mich aus und schaffe es nicht, meine Kleidung wegzuräumen, ich lege mich aufs Bett. Meine Tagesdecke ist hart und kratzt und ich liebe es, wie es sich an meinem Bauch anfühlt auf dieser sperrigen Decke zu liegen. Aber ich kann es nicht genießen, weil meine Kleidung noch herumliegt. Also stehe ich auf, lege meine Hose und meinen Pulli zusammen. Mir ist kalt. Ich räume auf, es wird immer dunkler und ich bekomme Gänsehaut. Dann ist mein Zimmer ordentlich. Ich lege mich unter die Kuscheldecke, die unter der Bettdecke liegt, die unter der Tagesdecke liegt. Ich höre nur meinen Atem und hoffe, dass ich schlafe. Mein Kopf ist leer, obwohl ich denke, aber ich kann mich, sobald ich daran denke, woran ich denke, nicht mehr erinnern, woran ich gedacht habe. Ich schließe die Augen. Ich öffne die Augen. Ich drehe meinen Kopf nach links, der Wecker mit den grünen Leuchtzahlen zeigt 17:48. Ich hatte gehofft, es wäre später. In Filmen vergeht die Zeit in Situationen wie der meinen doch schneller. Ich hatte gehofft es wäre früher, dann hätte ich noch genug Zeit, auch wenn ich nicht weiß, wofür. Ich atme ein, ich atme aus. Ich balle meine Hände zu Fäusten und werde wütend, weil ich heute nicht die Äpfel bekommen habe, die ich immer kaufe und deshalb ohne Äpfel nach Hause gegangen bin. Ich werde wütend, weil ich die Dunkelheit hasse, weil ich nichts sehe, wenn es dunkel ist, aber weil ich auch kein Licht einschalten kann, weil ich, wenn ich allein bin, in künstlichem Licht Kopfschmerzen bekomme. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich wütend bin. In mir brodelt es und ich bin so wütend, ich würde so gern schreien, aber aus mir kommt kein Ton. Ich drehe meinen Kopf nach links, der Wecker mit den grünen Leuchtzahlen zeigt 17:50. Ich schlage mit den Fäusten auf die Matratze, weil ich den Mann vor dem Supermarkt heute nicht bei meinem Spaziergang gesehen habe, weil ich woanders sein musste. Ich strample mit meinen Beinen weil ich so müde bin von diesem Treffen mit Freund*innen und weil ich so viel lieber den Mann vor dem Supermarkt bei meinem Spaziergang gesehen hätte als sie.
Mein Körper fühlt sich unendlich schwer an, also strample ich weiter mit den Beinen und schlage mit den Fäusten. Alles fühlt sich so dumpf an und mir ist zum Weinen zumute. Ich drehe meinen Kopf nach links, der Wecker mit den grünen Leuchtzahlen zeigt 17:54. Ich höre, wie ein Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt wird und wie er sich lautstark dreht. Ich werde panisch, will ich doch eigentlich nur allein sein. Ich höre, wie er die Wohnung betritt, seine Schuhe und seine Jacke auszieht und sie auf den Boden legt. Er sagt „Hallo“ und ich antworte nicht, weil ich weiß, dass er weiß, dass ich da bin. Ich höre, wie er in die Küche geht, ein Glas Wasser auffüllt und es in einem Zug lehrt. Es klirrt laut, als er das Glas auf die Anrichte stellt, das Geräusch schmerzt in meinen Ohren. Ich will allein sein, ich will, dass er geht. Ich will ihn nie wieder sehen. Aber er weiß, dass ich hier bin, weil ich immer hier bin. Ich höre, wie er ins Schlafzimmer kommt, wie er seinen Pulli auszieht und ihn über die Sesselkante legt. Er zieht eine Jogginghose an, ich mache meine Augen zu, obwohl es dunkel ist und ich ihn sowieso nicht sehe. Er weiß, dass ich hier bin. Er legt sich unter die Bettdecke, die unter der Tagesdecke liegt, weil er weiß, dass die Kuscheldecke meine ist. Er schlingt seine Arme um mich und ich liege da und spüre seinen Atem am Hals und mir rinnen langsam warme Tränen über die Schläfen. Seine Hände wandern unter die Kuscheldecke und lösen meine Fäuste, er schiebt seine Hände in meine und stockt, als er merkt, dass meine Hände klebrig sind. Er zieht seine rechte Hand nach draußen, aus dem Deckenstapel und im Licht der Straßenlaternen erkennt man dunkle Flecken, mein Blut, das vermutlich von den Wunden kommt, die entstanden sind, als sich meine Fingernägel in meine Handflächen gebohrt haben. Er sucht sich wieder einen Weg in die Decken und hält mich fest und ich will fliehen, weil ich weiß, dass ich irgendwann allein sein werde und ich mit diesem Gedanken nicht umgehen kann. Wie kann mich jemand lieben, wie kann mich jemand festhalten wollen? Ich drehe meinen Kopf nach links, der Wecker mit den grünen Leuchtzahlen zeigt 18:06. Ich höre ein Flugzeug, ganz nah und ich spüre Atem an meinem Hals, hin und wieder Küsse. Ich will weg von hier, weil ich so gern hier bin und mich aber nicht daran gewöhnen will, so gehalten zu werden.
Ich will nicht, dass es weh tut, nicht mehr gehalten zu werden.
Es ist Samstag. Ich war eine Banane einkaufen. Der Mann mit den Zeitungen war da. Ich war spazieren. Der Mann mit den Zeitungen war immer noch da. Der Hase war da. Es ist 18:09 und eigentlich wäre er jetzt da, aber jetzt ist niemand mehr da, sein Pulli ist weg, seine Jogginghose ist weg, seine Schuhe sind weg, sein Wasserglas ist weg. Und ich fühle mich frei, weil endlich das passiert ist, von dem ich wusste, dass es passiert. Meine Angst ist weg und da ist nur noch Schmerz. Meine Handflächen bluten. Ich drehe meinen Kopf nach links, der Wecker mit den grünen Leuchtzahlen zeigt 18:17.
39% der Menschen in Österreich sind oder waren laut einer Studie von einer psychischen Erkrankung betroffen. Durch die Pandemie sind besonders junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren besonders stark betroffen. Wenn es dir nicht gut geht, du dich nicht wohl fühlst, dir ständig Gedanken im Kopf herumkreisen, wenn du das Gefühl hast, du wirst überschwemmt oder wenn du mit jemandem reden möchtest, dann zögere nicht, um Hilfe zu fragen. Das ist das stärkste, was du für dich selbst machen kannst.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Unterstützung zu bekommen:
147 – Rat auf Draht für junge Menschen, die nicht mehr weiterwissen.
142 – Telefonseelsorge kann immer angerufen werden und gilt als vertrauliche Beratung.
info@kiz-tirol.at bietet Hilfe für junge Menschen in Not.
info@netzwerk-essstoerungen.at
Hier handelt es sich um eine rein fiktive Geschichte.
Bild: Claudia Ploner