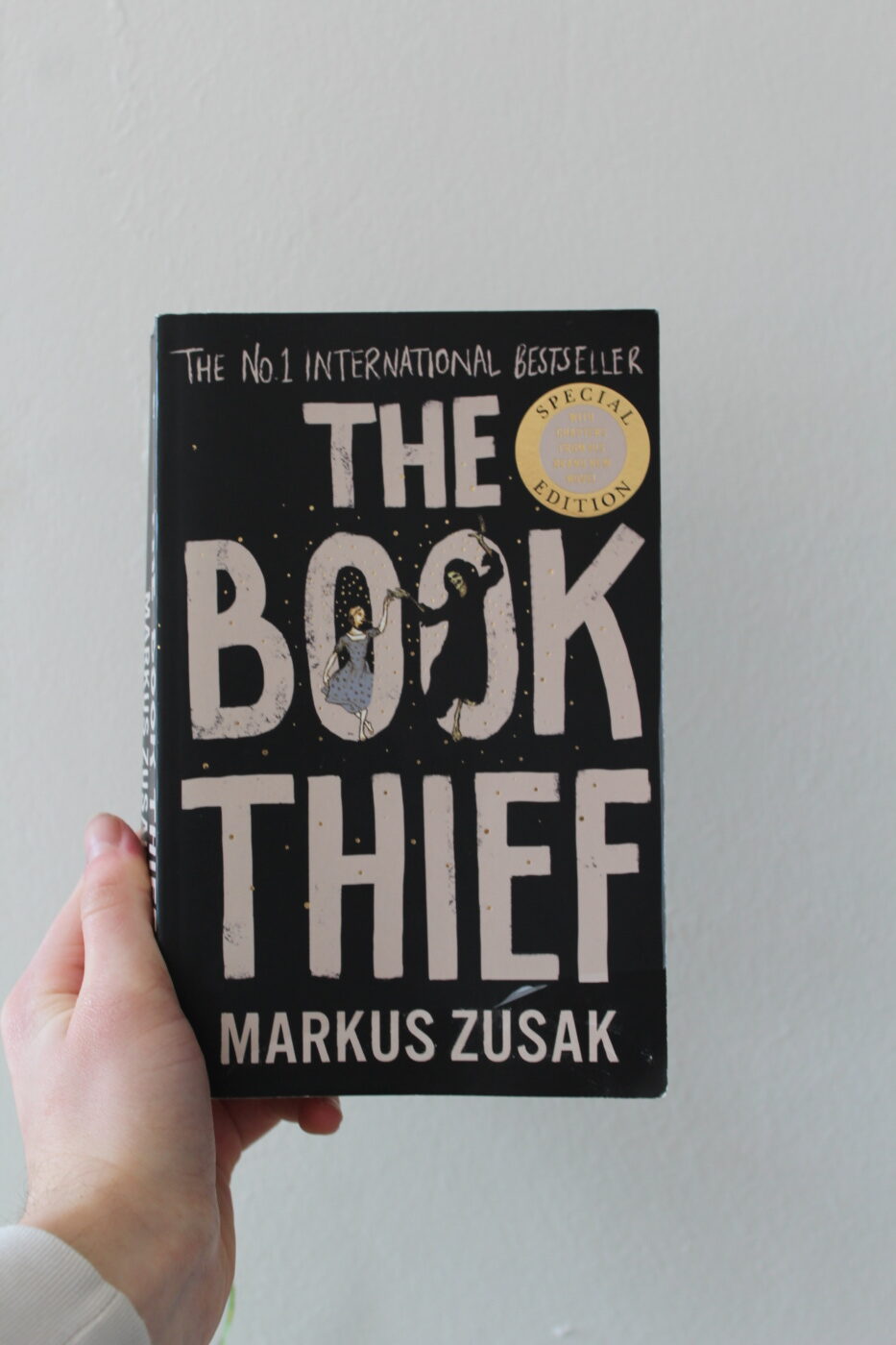Im Laufe des Sommers posten wir Artikel aus der Print-Ausgabe #16: „Über Menschen“.
Der Kellner in dem weißen Hemd und dem Jackett hat schon alles gesehen. Die Tourist*innen mit den hell blitzenden iPhone-Kameras, die wirken wie Spinnenaugen, die Urwiener*innen an ihrem Stammtisch sitzend und wie schon vor dreißig Jahren ihre Gulaschsuppe schlürfend, einander in einer altwienerischen Arroganz anschweigend, unverändert, stumme Zeug*innen einer außerhalb verstrichenen, hier drinnen angehaltenen Zeit. Dann noch die Reichen, für die die “Abgefucktheit” ein Abenteuer ist, ein Prestigeobjekt, ein Haken auf der Liste von Dingen, die man mal erlebt und gesehen haben muss, um dann auf Cocktail Partys und Empfängen von dem Charme und Flair dieses Ortes erzählen zu können, während man eiskalten Sekt aus kristallinen Gläsern trinkt und insgeheim froh ist, dass es hier nicht nach alten Gardinen und Hausmanns(frau!)kost riecht.
Und ich sitze da und frage mich wer ich in diesem Zirkus bin. Wen (was?) der Kellner in mir sieht, der meine Bestellung, Pfefferminztee, aufnimmt, mit eingefrorener Miene, ohne sich in die Karten blicken zu lassen. Ich will die Phantome der Gedanken fangen, die seit jeher zwischen den rotgestreiften Sofas, den überklebten Plakaten an den Wänden, der dunkelroten hohen Decke und dem dunklen Holzboden zirkulieren. Denn ich spüre, dass sie da sind. Das italienisch-sprachige Paar im Eck wirkt zufrieden miteinander in ihrer gemeinsamen, ab und zu durch oberflächliche Gespräche durchbrochenen Stille, wie ich es selten bei Paaren in ihrem Alter gesehen habe. Bei Paaren aus der Generation Ehe-bis-zum-Tod/alternativlos.
Ein älterer Herr, und eine etwas jüngere Frau, vielleicht seine Tochter, vielleicht auch nicht, umarmen sich, ohne dass ich erkenne, welche Emotion sie dazu treibt. Es ist eine lange Umarmung, innig, vertraut würde man sie wohl beschreiben, wenn einen jemand danach fragen würde, aber mich fragt niemand. Die Moleküle in der Luft um sie herum scheinen still zu stehen um sie nicht zu stören, um für sie die Zeit und den Moment anzuhalten. Um den Moment festzuhalten, wie sie sich festhalten. Sie sind mir zuvor nicht einmal aufgefallen, und auch nachdem sie sich voneinander gelöst haben, sind sie wieder einfach nur an einem Heißgetränk Nippende, hin und wieder auf ihr Handy Starrende, dann neugierig, fast erwartungsvoll in der Gegend Herumschauende, die sich in das Wimmelbild des Cafés eingliedern, als wäre nichts gewesen, als hätten sie nicht gerade das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinande r gebracht, bis sie komplett darin verschwimmen. Sie machen ein Foto von sich, rühren in ihren erkalteten Heißgetränken. In diesem kleinen Eckchen Welt, so abgeschottet von der Welt. Ein Ort, an dem draußen immer Nacht ist – eine klirrend, kalte Novembernacht, wie von Künstler*Innen auf einem Ölbild mit ausschließlich dunklen Farben gestaltet, und in dem es drinnen immer warm ist. Alles an diesem Ort ist warm. Es ist ein Ort, an dem Menschen sich verlieben. Ein Ort, an dem über Tode geweint, über Politik gestritten wird. Hier beginnen Ären, und gehen unter Lachen und Weinen zu Ende. Es schließen sich Freundschaften fürs Leben und Feindschaften fürs Leben. Hier werden Revolutionen geplant und wieder zerdacht. Hier trifft alt auf jung, rechts auf links, oben auf unten, ich auf dich, Vergangenheit auf Zukunft und erzeugt in dieser Kollision was wir Gegenwart nennen, schreibt das Präsens in das Gemenge der stickigen Luft der Präsenz der Menschen. Das Paar macht immer noch Bilder voneinander, die anschließend in zufriedenem Schweigen, sich gegenüber sitzend, aber weit voneinander entfernt in unterschiedlichen Welten seiend bearbeitet werden, geposted, einen Moment künstlich kreieren wird, auf Kosten des Momentes, der es eigentlich hätte sein können, aber dessen Potential von erleuchteten Displays überstrahlt wurde. „Zwa Kafetschal die Heaschofftn?“
Mit dem lauten Ruf gemeinsam zieht ein süßer Duft durch den Raum, der nacheinander die Köpfe der Menschen in dessen Richtung und ihre Augen groß wie die von Kindern an Weihnachten werden lässt, die es nach dem Zucker hinter den Schaufensterscheiben verzehrt.
Die Tische leeren sich und füllen sich, der Zigarettenrauch-Geruch ist nie aus den alten Polstermöbeln verschwunden. Der Kellner mit den weißen Handschuhen und der schwarzen Weste verschwindet in einer Kammer. Ein Mann kommt kurze Zeit später wieder heraus, mit einem Adidas Hoodie, einer Jogginghose und einer Baseballkappe. Ich bin irritiert, und irgendwie persönlich angegriffen und weigere mich zu glauben, dass es sich um die gleiche Person handelt, in dem kindischen Trotz, in dem ein Kind weiter an den Weihnachtsmann glaubt, auch wenn man ihm bereits alle zuvor aufgebauten Träume wieder zerschlagen hat. Und auch dieser Mann da zerstört mir meine Illusion einer fehlenden Außenwelt, wie in einem Film, in dem es für mich keine „Hinter den Kulissen“ geben soll, weil ich ihn mir ansehe, um ihm zu glauben. Um mich belügen zu lassen, um Eskapismus zu betreiben. Also bleibt für mich der Kellner in dem Cafe, und Adidas Pullover darf hingehen wo es ihn hinzieht. Vermutlich weg von diesem Ort, der für ihn so anders ist als für mich. Dieser Ort, dessen illusionierte Abgeschottetheit er bereits als Filter trägt, um sie nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Und ich stell mir vor, dass dieser Ort mitsamt den Personen, die wie Fabelwesen sind und zum Inventar gehören, wie die Marmortischchen und die dunklen Kleiderständer es tun, aufhört zu existieren, wenn irgendwann nach Unendlichkeiten die Lichter ausgeschaltet werden. Aber heute noch lange nicht, denn noch brummt hier der vibrierende Motor des Abends der von den Möglichkeiten der bevorstehenden Nacht beflügelten, angetriebenen Menschen auf der Suche nach Zerstreuung, oder etwas anderem, jemand anderem oder sich selbst, befeuert wird. Ich kann in diesem Wirrwarr treiben was ich möchte, mich treiben lassen auf dem Aufwind der Wärme der Bewegung. Ich will mich darin verlieren, und am besten etwas finden, mit dem ich nicht gerechnet habe. Mein verlorenes Ich vielleicht. Das ich in dem selben Tempo verloren habe, wie sich die Tische leerten, unmerklich, bis sie alle leer verblieben, bis auf zwei oder drei Paare, die sich noch in den Ecken herumdrücken. Der Abend scheint wie durch einen Dimmer langsam aber sicher abgedreht zu werden. Dann sind nur mehr ich und ein alter Mann da und ich bin mir sicher, dass er immer der Letzte hier ist. Dass er der Letzte ist, der den Heimweg durch die unerbittliche Stille der großen Stadt antritt, sich an dem Gefühl wärmend, der Letzte gewesen zu sein, und morgen wieder als erster die Welt des Cafés in der engen Gasse betreten zu können und wieder nach Hause kommen zu dürfen.
Ich nicke ihm zu, er mir auch, ich ziehe meinen langen schwarzen Mantel über meine warme Haut, wickle meinen Schal um den Hals und trete dem kalten Luftschwall entgegen, der mir die Kälte der Welt in Erinnerung ruft, als ich aus der Tür trete und in die Nacht entsteige.