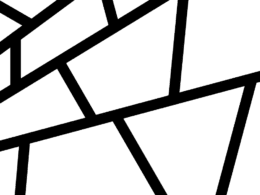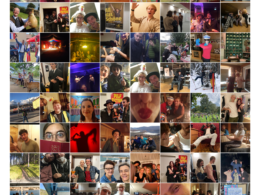Eine Liebeserklärung an die Innsbrucker Routine.
Ich unterteile Österreich immer ganz gern in Gesprächen mit auskunftsbedürftigen Ausländern und Fast-Ausländern (Wiener*innen) in Wien und Nicht-Wien. In Wien tummelt sich die Welt, und seit jeher zieht es auch alle Ambitionierten aus der Provinz den übrigen acht Bundesländern in die Hauptstadt, der*die nicht davor zurückschreckt, ihre Großstadtluft (verschwitzte Touristen und Obdachlose mit Fahnen) einzuatmen, durch die eigenen Lumpen zu pumpen und unbeeindruckt wieder von sich zu stoßen. Wien befindet sich im erbarmungslosen Dauerstress, alle scheinen zwischen ihren fünfzehn einzigartig-subversiven places to be hinundherzueilen, während sie mit der rechten Schulter voraus links an dir auf der Rolltreppe vorbeirempeln.
In Nicht-Wien hingegen scheinen die Uhren langsamer zu gehen; die Busse und vereinzelten Trams frequentieren bestenfalls im Zehnminutentakt, Bedarf für Rolltreppen ist nur in Einkaufszentren und Hauptbahnhöfen; Wer eilt, ist wohl ein Tourist. Nichtsdestotrotz finden sich auch in Nicht-Wien einige interessante Bezirke, in denen sich junge Nicht-Wiener*innen zum gemeinsamen kulturellen Austausch mit Einwander*innen aus Ländern nördlich und südlich der Alpen zusammenfinden: aus Leopoldstadt wird Graz, aus dem Neubau wird Linz, und Währing wandelt sich zu Innsbruck. Letztere Stadt im Westen Nicht-Wiens darf ich seit nunmehr zwei Jahren mein Zuhause nennen, der gleichermaßen im Gespräch mit Ausländer*innen und Fast-Ausländer*innen zu meinem immer dagewesenen Herkunftsort wird. Doch was macht meine Stadt aus? Inwieweit wird sie ihrer Antithese zu Wien gerecht, inwieweit reproduziere ich die Abgrenzung? Ich versuche, die Antworten darauf an einem unifreien Oktoberwochenende einzufangen, ein Gedanke pro Verlängerter.
Ein erster Anhaltspunkt bietet sich mir freitagmorgens im übervollen Café. Ich bin allein unterwegs und sehe mich gezwungen, der Innsbrucker Verschlossenheit entgegenzuwirken und einen fremden Mann um einen Platz an seinem Tisch zu bitten, welcher mir mit einem vorsichtigen Lächeln gewährt wird. Mein Gegenüber stellt sich als Mark, finance student aus Wien vor. Er sucht nach menschenleeren Straßen und Plätzen, mit denen er seine Vision der Stadt auf seiner Filmkamera festhalten möchte. Ich lade ihn auf eine Feier am Abend ein, aber er lehnt höflich ab. Er sei nicht hierhergekommen, um Menschen without consent zu fotografieren, vielmehr will er Bilder von der old town against the backdrop of mountains. Klassiker.
Samstagabends bereits sollte ich wieder in einem Café mit Wienern auf das Leben in Nicht-Wien zu sprechen zu kommen. Ob es hier denn genug zu tun gäbe, fragen sie mich und David. Wir erzählen ihnen von unserer vollen letzten Nacht, doch auch sonst gäbe es jeden Abend genug Möglichkeiten, sich bespielen zu lassen, man müsse nur die richtigen Leute und Plätze kennen, meinen wir. Wir entgegnen den überstimulierenden Massenattraktionen ihres Wiens mit versteckt-alternativen Kleinveranstaltungen unseres Nicht-Wiens, von denen man einfach implizit wissen müsste, um dabei sein zu können. Unser Versuch, so unsere Ebenbürtigkeit zu formulieren, ist jedoch ohne Erfolg: Sie wollen von uns wissen, ob wir schon einmal in Wien waren und ob wir einmal dorthin ziehen wollen. Wir bejahen. Wir fragen sie, ob sie schon einmal in diesem Teil Nicht-Wiens gewesen sind und ob sie sich einen Umzug hierher vorstellen könnten. Sie verneinen. Nur zur Durchfahrt. Aber die Berge sind urschön!
Nicht-Wien, und Innsbruck besonders, wird bekanntlich gerne für seine Berge und seine Wander- und Skirouten stereotypisiert – und das nicht zu Unrecht, wie beispielsweise die Dauerüberbuchung der hiesigen Kletterhalle und Skishuttlebusse belegt. Ein Label als hippe, und zugleich idyllische Alpenstadt (derogatory), mit dem ich mich auch in meinem dritten Jahr noch nicht anfreunden kann. Ich fordere nach wie vor den Tod von Beanies und Holzfällerhemden sowie ein Ende des Bäckereimonopols des Ruetz und der Schreckensherrschaft des Partykiller-Magistrats und der 90s-Schwulen in Gaybars, und doch fühle ich mich hier als Nicht-Wiener unglaublich wohl. Gerade weil sie nicht Wien ist, hat sie mir vor zwei Jahren so einen leichten Start ins Leben außerhalb des Elternhauses ermöglicht hat und mich zum Erwachsenen geformt hat, der ich heute schon fast bin. Für den Moment genieße ich die Ruhe der Routine der Stadt und bin ein Nutznießer ihrer Tranquillität, wenn ich mein Wochenende ungestört in den gleichen Cafés verbringen kann, ohne auf die Uhr, meine Mitmenschen oder Fahrpläne schauen zu müssen oder von einer peniblen Bedienung zum Platz machen genötigt zu werden, egal wie geizig ich konsumiere.
Und so werde ich sonntagnachmittags, nach der Abreise sämtlicher Wiener*innen, gleich wie freitagmittags, freitagabends und samstagmorgens, wieder ins Café gerufen. Es ist das gleiche Café (Hokus), der gleiche Tisch (im Garten, damit Veronika tschicken kann), die gleiche Bestellung (Verlängerter), das gleiche Gespräch (Familien- und Freundeklatsch) wie immer, nur, dass an Davids Stelle heute eine 17-jährige Buzzcutblondine am Tisch sitzt. Wir teilen die Spielkarten aus und wiederholen zuerst die Regeln für Gabo (ich), dann für Roter König (Veronika), und zuletzt für Tablići (Anja). Wir spielen unangebracht laut, rücksichtslos und kompetitiv, erst Laras leise Ankunft am Tisch bringt uns wieder zum Schweigen. Die Spielkarten verschwinden unterm Tisch, und schon zieht sich eine*r nach der*m anderen auch schon wieder zurück, bis nur noch Lara und ich übrigbleiben. Wir lesen unsere Lektüren, schlürfen unsere Kaffeetassen und begleichen unsere Rechnungen in wie abgesprochener Stille, jede*r für sich. Später dann, als auch wir endlich in der Dunkelheit unseren zwanzigminütigen Heimweg antreten, erzählen wir uns von unseren Wochenenden, erstellen Persönlichkeitsprofile derer Haupt- und Nebencharaktere und notieren daraus neue Zitate für die Zukunft. Wir trennen uns vor meiner Haustür und wissen, dass wir morgen, übermorgen, und am Wochenende in aller Ruhe doch genau das gleiche machen wollen.
Titelbild: Lea Zaletel